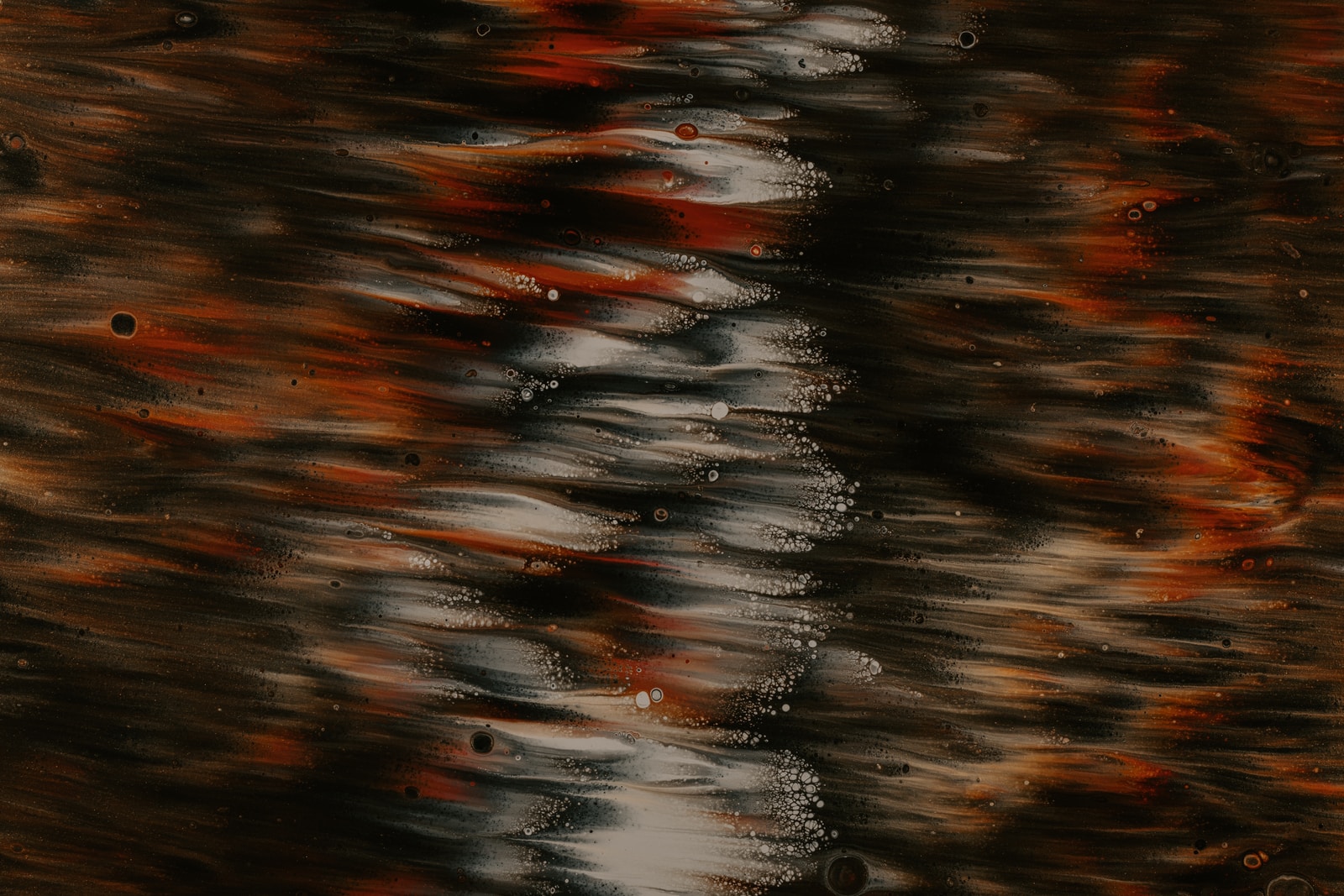Vor 60 Jahren, im Dezember 1963, begann in Frankfurt am Main der Auschwitz-Prozess. Für die Entwicklung der Bundesrepublik und der deutschen Nachkriegsdemokratie war er von maßgeblich prägender Bedeutung. Von nun an konnte die deutsche Gesellschaft nicht mehr über die Systematik ebenso wie die grauenvollen Einzelheiten des beispiellosen Verbrechens hinwegsehen, dessen sich Deutschland schuldig gemacht hatte – auch, wenn es über die Jahre hinweg nicht an Versuchen fehlte, dessen Singularität zu relativieren. Heute ist der Holocaust, wie die NS-Judenvernichtung erst seit den späten 1970er Jahren genannt wird, so umfassend und bis ins Detail erforscht und dokumentiert wie vielleicht kein anderes Ereignis in der Geschichte. Gleichzzeitig aber wachsen der Missbrauch, die politisch-ideologische Instrumentalisierung und offene Verfälschung der Holocaust-Erinnerung in ungeahnte Dimensionen (s. dazu meinen Essay in der aktuellen Ausgabe der Zeitschtift Internationale Politik).
Und als Folge das bestialische Massakers der Hamas an über 1400 israelischen Zivilisten, der schlimmsten antijüdischen Mordaktion seit der NS-“Endlösung”, wird auf die Probe gestellt, was das von der deutschen Demokratie zu ihrer obersten Maxime erklärte “Nie wieder” tatsächlich wert ist – jener Maxime, die aus dem Auschwitz-Schock von 1963-1965 erwuchs. Zu diesen Anfängen der Konfrontation mit der bodenlosen historischen Wahrheit lesen Sie im Folgenden meinen Artikel, der im Dezember 2003 zum 40.Jahrestag des Beginns des Auschwitz-Prozesses in der “Zeit” erschienen ist:
Am Anfang der Wahrheit
Würde man sie nur an der Zahl der Täter messen, die von deutschen Gerichten verurteilt wurden, wäre die bundesrepublikanische Aufarbeitung des Holocaust alles andere als ein Ruhmesblatt. Seit 1958, als mit der Einrichtung einer Zentralen Stelle der Justizverwaltungen in Ludwigsburg überhaupt erst eine systematische Verfolgung von NS-Verbrechen durch die hiesige Justiz begann, wurden weniger als 500 Personen wegen ihrer Beteiligung an der organisierten Judenvernichtung bestraft. Nur 100 der 4500 Personen, die zwischen 1945 und 1949 wegen NS-Delikten vor deutschen Gerichten standen, waren wegen Tötungsverbrechen angeklagt worden.
Auch der Frankfurter Auschwitz-Prozess, der vor genau 40 Jahren, am 20. Dezember 1963 begann, endete mit Strafzumessungen, die in keinem Verhältnis zu den grauenhaften Verbrechen standen, die im Prozessverlauf enthüllt worden waren. Von den 22 Angeklagten, die keine Einsicht oder Reue zeigten, wurden am 19. August 1965, nach zwanzigmonatiger Prozessdauer, 6 zu lebenslangem Zuchthaus, 11 weitere zu Freiheitsstrafen zwischen dreieinhalb und 14 Jahren verurteilt. 3 wurden freigesprochen, 2 schieden wegen Tod beziehungsweise Krankheit vorzeitig aus dem Verfahren aus.
Dennoch hat dieser Prozess wie kaum ein anderes Ereignis der deutschen Nachkriegsgeschichte das Selbstverständnis der Bundesrepublik verändert. Zusammen mit dem Eichmann-Prozess 1961 in Jerusalem hob er die unvergleichbare Dimension der nationalsozialistischen Judenvernichtung erstmals massiv ins Bewusstsein der Weltöffentlichkeit. Zwar hatten die von den Alliierten geführten Nürnberger Prozesse bereits den Tatbestand der “Verbrechen gegen die Menschlichkeit” verfolgt. Doch spielte er damals neben den Delikten “Kriegsverbrechen” und “Verbrechen gegen den Frieden” nur eine untergeordnete Rolle. Nach den Enthüllungen im Frankfurter Prozess aber war die Identitätssuche der deutschen Demokratie nicht mehr von dem vollständigen Wissen darum zu trennen, dass es Auschwitz gab und was es bedeutete. Auschwitz, als Chiffre für das Äußerste, das Menschen anderen Menschen antun können, bezeichnet seitdem den Abgrund, der unter der zivilisatorischen Oberfläche selbst einer hoch entwickelten, modernen Gesellschaft wie der deutschen lauern kann.
Schuld in qualvollen Details
Ob man in Auschwitz nun aber das Resultat einer unheilvollen Fehlentwicklung der deutschen Geschichte oder das Menetekel der modernen Zivilisation insgesamt sehen wollte – unverrückbar blieb, worauf die Philosophin Hannah Arendt, in einem Briefwechsel mit Hans Magnus Enzensberger, 1965 hingewiesen hatte: Die bisher einzige planvoll betriebene Ausrottung einer gesamten, von den Verfolgern einer zu vernichtenden “Rasse” zugeordneten Menschengruppe ist nun einmal von Deutschland ausgegangen und von Deutschen ins Werk gesetzt worden. Alle Versuche, den Holocaust in generalisierende metaphysische oder geschichtsphilosophische Erklärungsmuster aufzulösen und damit das “Spezifische, Partikulare” deutscher Schuld zu verdecken, würden, so Arendt, an diesem unverrückbaren Faktum ihre Grenze finden.
Der deutschen Öffentlichkeit diese konkrete Schuld in qualvollen Details – die in zahlreichen Zeugenaussagen von Opfern und durch die Rekonstruktion durch Sachverständige ans Licht kamen – vor Augen geführt und sie in einer Urteilsbegründung von fast eintausend Seiten festgehalten zu haben ist die große Leistung des Prozesses. Um das Verdienst der anklagenden Staatsanwälte und des Gerichts würdigen zu können, muss man die Voraussetzungen betrachten, unter denen es zu diesem Verfahren gekommen war. Die frühe Phase der “Vergangenheitsbewältigung” war von dem Wunsch nach “Vergessen” und “Bereinigen” des Vergangenen, nach dem berüchtigten “Schlussstrich” geprägt.
Eines der ersten Gesetze, die vom Parlament der frisch gegründeten Bundesrepublik verabschiedet wurden, war das Straffreiheitsgesetz von 1949, das alle vor dem 15.September dieses Jahres begangenen Taten, die mit Gefängnis bis zu sechs Monaten beziehungsweise bis zu einem Jahr auf Bewährung geahndet werden konnten, amnestierte. Es folgten 1950 die Empfehlung des Bundestags, die Entnazifizierung zu beenden, 1951 das Gesetz zum Grundgesetz-Artikel 131, das die Rückkehr von NS-belasteten Angehörigen des öffentlichen Dienstes auf ihre alten Stellen ermöglichte, und 1954 ein erweitertes Straffreiheitsgesetz, das für Delikte, die mit Strafen bis zu drei Jahren belegt waren – somit selbst für vorsätzliche Tötungen bei mildernden Umständen – Straffreiheit in Aussicht stellte. Seit 1951 wurden zahlreiche Kriegsverbrecher, die von alliierten Militärgerichten verurteilt worden waren, begnadigt. Eine 1955 zwischen der Bundesregierung und den Alliierten getroffene Vereinbarung schloss Verfahren gegen Personen aus, die bereits von alliierten Gerichten abgeurteilt worden waren. So blieben NS-Täter, selbst wenn gegen sie neues Material vorlag, von weiterer rechtlicher Verfolgung verschont.
Aufklärung auf Sparflamme
Diese Maßnahmen folgten dem von der allgemeinen Volksstimmung gestützten Bestreben, die “Aufrechnung” früheren Unrechts möglichst schnell abzuschließen und das “Vergangene ruhen zu lassen”. Nicht nur nationalistische Kräfte mit restaurativer Absicht dachten so. Auch unzweifelhaft antinazistisch eingestellte Persönlichkeiten wie Konrad Adenauer, der erste FDP-Justizminister Thomas Dehler oder der SPD-Abgeordnete Fritz Erler betrieben eine “Vergangenheitspolitik” (wie der Historiker Norbert Frei es nannte) rascher “Normalisierung” – galt es doch, die Institutionen der jungen Demokratie zu stabilisieren und die große Zahl der “kleineren” NS-Täter und “Mitläufer” nicht von der Mitarbeit am Neuaufbau abzuschrecken.
Die Motive der deutschen Justiz, die Aufklärung von NS-Verbrechen auf Sparflamme zu halten, lagen auf der Hand. Waren doch zahlreiche ihrer Angehörigen durch ihre Verstrickung in das NS-Unrechtssystem – zumindest moralisch – selbst belastet. Kam es in den ersten 13 Nachkriegsjahren überhaupt zu Verhandlungen vor deutschen Gerichten, geschah dies nicht auf Initiative der Behörden, sondern aufgrund individueller Anzeigen oder ausgelöst durch Zufälle. Durch einen solchen zufälligen – und besonders kuriosen – Umstand war etwa der Ulmer Einsatzgruppen-Prozess von 1958 ins Rollen gekommen, der durch seine Enthüllungen über die SS-Kommandos, die in Russland gemordet hatten, großes Aufsehen erregte. Ein 1945 untergetauchter NS-Täter, der 1941 als Polizeidirektor in Memel an der Tötung Hunderter Juden beteiligt war, klagte Mitte der fünfziger Jahre auf Wiedereinstellung in den Staatsdienst. Im Zusammenhang mit diesem Verfahren wurden seine Verbrechen publik – und er erhielt wegen Beihilfe zum Mord zehn Jahre Zuchthaus.
Auch die Vorgeschichte des Frankfurter Prozesses verlief nach diesem Muster. Die Strafanzeige eines ehemaligen Kapo, der zu diesem Zeitpunkt wegen eines kriminellen Delikts im Landesgefängnis Bruchsal einsaß, führte 1958 zur Enttarnung und Verhaftung von Wilhelm Boger, einem besonders berüchtigten Folterer der Politischen Abteilung in Auschwitz. Boger hatte bis zu seiner Verhaftung unter seinem richtigen Namen unbehelligt in Stuttgart gelebt. Das Internationale Auschwitz-Komitee in Wien benannte Zeugen und weitere Täter und trieb die zunächst zögernd anlaufenden staatsanwaltlichen Ermittlungen an. Boger war später einer der Angeklagten des Auschwitz-Prozesses, die mit lebenlangem Zuchthaus bestraft wurden.
Fritz Bauers Beitrag
Dass der Prozess überhaupt zustande kam, war jedoch vor allem der Energie des hessischen Generalstaatsanwalts Fritz Bauer zu verdanken. Er drang darauf, die Verfahren gegen die verschiedenen Auschwitz-Täter, deren die Justiz habhaft geworden war, in einem Prozess zusammenzufassen. Er übertrug die Ermittlungen jungen Staatsanwälten, die nicht in die NS-Vergangenheit verstrickt waren. Der Versuch der Staatsanwaltschaft, mit dem Prozess ein neues Prinzip in der Rechtsprechung zum Holocaust zu etablieren, blieb freilich erfolglos. Bauer und seine Mitstreiter fassten den Judenmord als ein einziges, zusammenhängendes Verbrechen auf. Alle, die auf den verschiedensten Ebenen an ihm beteiligt waren, hätten demnach wegen Mittäterschaft zur Rechenschaft gezogen werden können. Diese Auffassung konnte sich in der Rechtsprechung jedoch nicht durchsetzen.
In keinem Verhältnis zu den rechtlich-normativen Folgen des Auschwitz-Prozesses stand aber seine Wirkung auf das geistige Klima der Bundesrepublik. Unter dem Eindruck, den der ungeschützte Blick in die Mordmaschine des Nationalsozialismus besonders auf die erste Nachkriegsgeneration machte, begann, was die Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann die “zweite Phase der bundesdeutschen Erinnerungsgeschichte” nennt: “Der Impuls unerbittlichen Nachfragens wurde nun in die bürgerlichen Wohnstuben, in die Gerichtshöfe und in die Archive getragen.”
Doch diese “zweite Phase” brachte nicht nur eine Schärfung aufklärerischen Geschichtsbewusstseins mit sich. Seit Auschwitz aus der geschichtlichen Selbstvergewisserung der Deutschen nicht mehr wegzudenken war, musste die Schuld, wie der Historiker Y. Michal Bodemann formulierte, “in einen nationalen Korpus integriert” werden. Damit wurde aber gleichzeitig versucht, “sie in diesem Korpus zu neutralisieren”.
Entlastung mittels Antiamerikanismus
Dieser Prozess ging zum Teil verschlungene Wege. Das Wissen über Auschwitz wirkte nicht zuletzt als Triebkraft der Radikalisierung und Ideologisierung, die sich in der Studentenbewegung abspielte. Deren Flucht in revolutionär-marxistische Welterklärungsmodelle kann auch als eine Variante des Versuchs verstanden werden, sich von dem quälenden Bewusstsein nicht wieder gutzumachenden Unrechts zu entlasten, indem man, wie es Hannah Arendt ausgedrückt hatte, die “Sauce des Allgemeinen” darüber schüttete. Fassungslosigkeit, Scham und Zorn über das, was in der Vätergeneration an Dehumanisierung möglich geworden war, mischte sich bald mit dem ohnmächtigen Gefühl junger Deutscher, die historische Folgelast einer kaum erträglichen Vergangenheit geerbt zu haben.
In seinem 1965 erschienenen Aufsatz Unser Auschwitz äußerte der Schriftsteller Martin Walser seine Skepsis, ob das Grauen von Auschwitz in einer seiner beipiellosen Abgründigkeit angemessenen Sprache wiederzugeben sei und tatsächlich in das kollektive Gedächtnis der Deutschen Eingang finden könne. Walsers Reflexionen waren in dieser Hinsicht bereits ein Vorgriff auf das Thema seiner heftig umstrittenen Paulskirchen-Rede 1998, in der er ja auch die Unmöglichkeit postulierte, Auschwitz öffentlich zu erinnern. Damals, in den sechziger Jahren, stand sein Vorbehalt freilich noch unter dem Vorzeichen einer radikalen Systemkritik. Walser beklagte die Folgenlosigkeit des öffentlichen Entsetzens über die Enthüllungen des Prozesses. Die täglichen Schlagzeilen über die Greueltaten der Täter hätten, schreibt Walser, beim Leser sogleich einen Reflex der historischen Distanzierung ausgelöst: Das waren nicht wir, die da gehören nicht zu uns!
Das Mitläufertum, das sich auf diese Weise von aller Mitschuld freigesprochen hätte, setzte sich in Walsers Augen nach dem Krieg in der bedingungslosen Gefolgschaft fort, die die Westdeutschen gegenüber den USA an den Tag legten. Im Antikommunismus des Kalten Kriegs sah er das modifizierte Fortwirken jener Energie, die “sich in Auschwitz austobte”. Zeitgleich forderte Walser vehement zum Engagement gegen den Krieg der Amerikaner in Vietnam auf. Gerade “wir Deutschen” müssten, so schrieb er 1967, “dem Amerika, das den Krieg führt, mehr als Vorhaltungen machen. Wir haben schließlich Erfahrung in Selbstverblendung.” Noch radikaler warf im gleichen Jahr Hans Magnus Enzensberger den USA Weltherrschaftspläne vor und wies darauf hin, dass sie über eine noch viel schrecklichere Vernichtungstechnologie verfügten als die Nazis. In der vergröberten Version gerann dieser Gedanke zum beliebten Demo-Slogan: “USA-SA-SS” – ein Slogan, der auch zeigt, auf welch krude Weise junge Deutsche, die sich der Schrecknisse der eigenen Geschichte bewusst geworden waren, versuchten, projektiv den Widerstand nachzuholen, den die Eltern versäumt hatten. So wollten sie sich von der lähmenden Handlungshemmung durch das trostlose Wissen um die nicht wieder gutzumachenden Grauen der eigenen Geschichte befreien.
Urmuster Auschwitz
Während die radikale Linke über den Umweg weltrevolutionärer Projektionen nach historischer Entlastung suchte, begann in der Ära der sozial-liberalen Koalition und im Zuge der Ostpolitik die Inkorporierung der Erinnerung an die Schrecken der NS-Zeit in das staatspolitische Selbstverständnis der Republik. Diese Entwicklung setzte sich auch nach der Ablösung der SPD/FDP-Koalition fort. Ihren Höhepunkt erreichte sie 1996 mit der Einführung des Holocaust-Gedenktages am 27. Januar und 1999 mit dem Beschluss des Bundestages, in Berlin ein Mahnmal für die Opfer der Judenvernichtung zu errichten. Dass diese Projekte von einer konservativ-liberalen Regierung unterstützt worden waren, markiert eine drastische Veränderung. War die NS-Herrschaft in den fünfziger Jahren als eine nationale Katastrophe betrachtet worden, als deren erstes Opfer sich die Deutschen selbst sahen, galt sie nun auch nach offizieller Lesart als singulärer und exemplarischer Zivilisationsbruch. Da er von Deutschland verursacht worden war, erscheint es nun gleichsam als Pflicht der Deutschen gegenüber der gesamten Menschheit, das Gedenken an diesen unvergleichlichen historischen Einschnitt wachzuhalten, damit er sich nirgendwo wiederholen möge.
Das Bekenntnis zur Erinnerung ist damit sozusagen deutsche Staatsräson geworden. Dies ist das Resultat einer dritten Phase der Erinnerungsgeschichte, die Ende der siebziger Jahre einsetzte und in der das stattfand, was man die Universalisierung oder Globalisierung des Auschwitz-Gedenkens nennen kann. Markiert wird dieser neue Abschnitt durch den großen Erfolg der amerikanischen Fernsehserie Holocaust, die hierzulande erstmals 1978 ausgestrahlt wurde. Das vertraute Familienserienmuster erlaubte es dem Zuschauer, sich direkt mit den Opfern der Judenverfolgung zu identifizieren. Die Resonanz beim deutschen Publikum war enorm. Was jahrzehntelange zähe Aufklärung in Mahnreden, im Schulunterricht und in Ausstellungen nicht erreichte, gelang mit dieser Serie im Handstreich: Die Anteilnahme am Schicksal von Holocaust-Opfern wurde großen Teilen der deutschen Bevölkerung zur Herzensangelegenheit.
Dass Auschwitz dergestalt zum idealtypischen Urmuster organisierter Menschenverachtung avancierte, brachte freilich auch eine Entleerung des Begriffs mit sich. Keine weltpolitische Debatte, sei es über Kosovo oder Irak, kommt mehr ohne den Hinweis auf die – gegensätzlich ausgelegte – “Lehre von Auschwitz” aus. Und in Deutschland entstand durch die Aneignung der Auschwitz-Erinnerung qua Universalisierung des Leids eine eigenartige neue Form des nationalen Selbstbewusstseins, das pointierte Kritiker mit dem Begriff “Sündenstolz” bezeichnet haben: Gerade weil wir Deutschen uns der eigenen Vergangenheit so schonungslos stellen, lautet die Logik dieser Denkfigur, sind wir dem Rest der Welt moralisch ein Stück voraus.
Ob allerdings mit der “Verstaatlichung” des Holocaust-Gedenkens dessen dauerhafte Verinnerlichung in der Gesellschaft einhergegangen ist, muss bezweifelt werden. Seit die Relativierung des Holocaust aus dem öffentlichen Diskurs “innerhalb des Verfassungsbogens” (Edmund Stoiber) verbannt ist, lebt das Ressentiment gegen die Pflicht zur Erinnerung in diffusen Räumen der indirekten Rede weiter, wie der Fall Hohmann jüngst gezeigt hat. Mit wachsender zeitlicher Distanz droht die lebendige Erinnerung an die realen Verbrechen von damals zu verblassen. Dagegen, dass sie ganz verschwindet, steht die historische Wahrheit, die im Auschwitz-Prozess für alle Zeit festgehalten wurde.